Die Kanzel
Die Kanzel

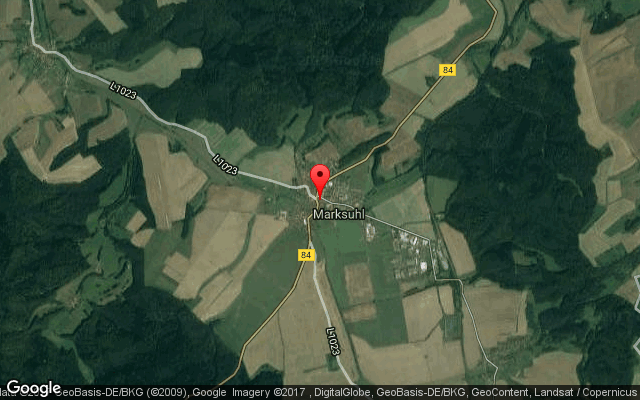
Die Geschichte der Kirche ist erst mit dem Bau des markanten Turmes ab 1454 nachweisbar. Der 30-jährige Krieg verwüstete das Gotteshaus. Im Jahr 1667 erfolgte der Wiederaufbau. Aus jener Zeit stammen die Kanzel und die Emporen. Den Rokoko-Prospekt der Orgel erhielt die Kirche 1770. Das Chorfenster ist ein Werk Kurt Thümmlers von 1986. Durch die übermalung der Emporen-Gemälde anlässlich des 300. Reformationsjubiläums 1817 wirkt der Raum nüchtern. So fällt die üppig ornamentierte Kanzel noch mehr ins Auge.
Die Brüstungsfelder schmücken Fruchtbündel. Es sind Äpfel, die als Symbol für den Sündenfall stehen. Einige Früchte ähneln Quitten oder auch Granatäpfeln, die Liebe und die Passion Christi symbolisieren.
Kanzeln gehören zu der wichtigsten Ausstattung in Kirchen, weil sie der Ort der Verkündigung des Wortes Gottes sind. Sie verbreiteten sich im deutschen Sprachgebiet ausgehend von den Bettelorden seit dem 13. Jahrhundert. Deren Prediger nutzten erhöhte, tragbare Holzstände. Im 15. Jahrhundert entstanden feste Kanzeln an Seitenpfeilern. Mit der Reformation gewann die Predigt an Bedeutung. Sie erschien gleichrangig neben dem Altarsakrament. Kanzeln rückten im Raum nach vorne, in die Nähe des Altars. Brüstungsfelder, Schalldeckel und Aufgänge boten Flächen, um die Auslegung der Bibel künstlerisch einzurahmen.
Die Kirche wurde dem Heiligen Hubertus geweiht, der als Patron der Jäger gilt. Die Liebe der Herzöge von Sachsen-Coburg-Eisenach bzw. Sachsen-Eisenach zur Jagd mag dieses Patronat erklären. Das Marksuhler Schloss diente ihnen als Jagdschloss und zeitweise auch als Residenz. Seit 1735 führte ein Gang vom Schloss zur Herrschaftsloge in der Kirche.
Die Baugeschichte der St. Hubertus-Kirche von Marksuhl ist erst ab 1454 nachweisbar, als der Bau des Turmes ausgeführt wurde. Sicherlich gab es schon eine Vorgängerkirche, von der aber nichts bekannt ist. Den markanten Turm krönen eine hohe Mittelspitze und vier kleineren Spitzen an den Ecken. Nach den Verwüstungen des 30jährigen Krieges wurde die Kirche 1667 wieder aufgebaut und erhielt im Inneren zweigeschossige Emporeneinbauten und die Kanzel. Von 1770 stammt der Rokoko-Prospekt der Orgel. Auch im Zweiten Weltkrieg erlitt die Kirche Zerstörungen, die bis 1955 behoben werden konnten. Im Chor fällt das Licht durch ein modernes Glasfenster, das 1986 von Kurt Tümmler entworfen wurde.
Zum 300. Reformationsjubiläum 1817 erfolgte die Übermalung der Emporen-Gemälde. Damit wurde der Kirche ein recht nüchternes Aussehen gegeben. Die üppig ornamentierte Kanzel fällt dadurch noch mehr in den Blick. Sie steht an der Südseite des Triumphbogens und hat den Grundriss eines Siebenecks. Die Sockel der gedrehten Brüstungs-Säulen bilden Akanthusblätter und Engelsköpfe. Dieser Zierrat findet sich auch am Schalldeckelt wieder. In den Brüstungsfeldern bilden Fruchtbündel den Schmuck. Bei den Früchten handelt es sich um Äpfel, die als Symbol des Sündenfalls stehen und den Hörer der Predigt auffordern könnten, seine Sünden zu erkennen. Einige Früchte ähneln aber auch Quitten, die wiederum Liebe symbolisieren. Das könnte sich auf die Liebe Jesu beziehen, die er der Welt mit seinem Evangelium entgegenbringt und die uns auffordert zu büßen und einander zu verzeihen. Ursprünglich stand die Kanzel auf einer Kolossalfigur des Moses, die heute im Thüringer Museum in Eisenach untergebracht ist. Die Verkündigung des Evangeliums stützte sich damit auf den jüdischen Urvater, der gleichzeitig das Alte Testament personifiziert.
Kanzeln gehören zu den wichtigen Ausstattungsstücken in Kirchen, weil sie der Ort der Verkündigung sind. Sie verbreiteten sich im deutschen Sprachgebiet seit dem 13. Jahrhundert ausgehend von den Bettelorden. Deren Prediger nutzten bewegliche, erhöhte Stände, die sie zum Predigen außerhalb und innerhalb der Kirchen errichteten. Seit dem 15. Jahrhundert setzten sich feste Kanzeln an Seitenpfeilern durch. Mit der Reformation gewann die Predigt an Bedeutung. Sie erschien im Ritus gleichrangig neben dem Altarsakrament. Die hohe Bedeutung der verständlichen Vermittlung des Wortes führte dazu, dass Kanzeln im Kirchenraum nach vorne, in die Nähe des Altars rückten. Brüstungsfelder, Schalldeckel und Aufgänge boten reizvolle Flächen, um der Auslegung der Heiligen Schrift auch einen optisch ansprechenden Rahmen zu geben.
Kirchenöffnung:
| Mo – Mi: | Frau Gernand | 03 69 25-90034 |
| Kantorin Hofmann | 03 69 25-90965 | |
| Pfarramt | 03 69 25-60334 |
| Do – Sa: | von 10:00 – 18:00 Uhr geöffnet |